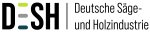Es war mit großer Geste, als Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im Juli verkündete: „Ich habe heute das rechtsextremistische Compact-Magazin verboten.“ Dieser – vermeintliche – Paukenschlag erwies sich jedoch als juristischer Fehlschlag. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig setzte das Verbot der umstrittenen rechtsradikalen Zeitschrift in einem Eilbeschluss aus. Zwar sahen auch die Richter, dass Compact Inhalte enthält, die die Menschenwürde verletzen. Da aber das „Gesamtbild“ differenzierter sei, möchten sie sich im kommenden Februar in Ruhe mit der Zeitschrift beschäftigen. Faeser war zunächst also kein „harter Schlag gegen die rechtsextreme Szene“ gelungen, wie sie getönt hatte. Es war eher ein Schlag ins Wasser.
Anhänger eines Parteiverbots der AfD sollten diesen Fall penibel studieren. Er zeigt gut die Fallstricke rund um Verbote im deutschen Rechtsstaat. Natürlich ist die Lage unbequem im politischen System Deutschlands. In den zehnten Direktwahlen zum Europäischen Parlament gewann das radikal rechte Parteienspektrum deutlich hinzu – auch in Deutschland. Die AfD konnte ihren Anteil um fast fünf Punkte auf knapp 16 Prozent steigern. Trotz schwerer Affären und Skandale in den eigenen Reihen schnitt sie besser ab als in den Umfragen erwartet. Die innen- und außenpolitischen Turbulenzen in der Migrations- (Sicherheit) und der Ukrainepolitik (Frieden) schadeten vor allem den drei Regierungsparteien im Bund.
Die Union behauptete sich, profitierte jedoch kaum von den herben Verlusten der zerstrittenen Ampelkoalition. Besonders die Grünen strafte die Wählerschaft ab. Die Linke ist nach der Abspaltung der Gruppe um Sahra Wagenknecht in einem desolaten Zustand. Bei der 13. Wahl in Folge verlor sie Stimmen; ihr Anteil wurde halbiert. Von einer derartigen Schlappe dürfte sie nicht mehr gesunden. Das Wahlverhalten unterscheidet sich deutlich zwischen Ost- und Westdeutschland. Bundesweit erreichten die drei im Bund regierenden Parteien ganze 31 Prozent, im Osten nicht einmal 20 Prozent. Die AfD erzielte in den neuen Bundesländern 28,7 Prozent, das noch ostlastigere BSW 14,4 Prozent.
Jetzt ist guter Rat teuer. Schnell wird ein Verbotsantrag gegen die AfD ins Spiel gebracht. Immerhin gilt sie bundesweit als rechtsextremer Verdachtsfall. Gewiss, die Bundesrepublik Deutschland ist eine streitbare Demokratie, basierend auf Wertgebundenheit, Abwehrbereitschaft und Vorverlagerung des Demokratieschutzes. Die Wertgebundenheit zeigt sich im „Ewigkeitsgebot“ des Artikels 79, Absatz 3 Grundgesetz, der bestimmte Artikel des Grundgesetzes für unantastbar erklärt. Die Abwehrbereitschaft manifestiert sich in der Möglichkeit von Vereins- (Art. 9, Abs. 2 GG) und Parteiverboten (Art. 21, Abs. 2 GG). Nach Artikel 18 dürfen einzelnen Personen gar Grundrechte entzogen werden. Die Vorverlagerung des Demokratieschutzes greift oft schon vor Gesetzesverstößen ein – das ist eine heikle Sache.
Es wäre ein Fehler, sich in einer kopernikanischen Wende von der streitbaren Demokratie abzuwenden, die auch legales Verhalten ins Visier nimmt, und zum Weimarer Werterelativismus zurückzukehren. Das lehrt uns die Geschichte. Dennoch verdient der Gedanke Gehör, auf schweres Geschütz wie Parteiverbote zu verzichten. Sie bedeuten einen gravierenden Eingriff in die politische Willensbildung. Ein zurückhaltender Gebrauch des Vereinsverbots wäre jedenfalls kein Nachteil. Auf diese Weise näherte sich die Bundesrepublik Deutschland anderen westlichen Demokratien an – und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
Im Auge behalten
Eine mildere Form der streitbaren Demokratie wäre zu bevorzugen. Parteien, die gegen die Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verstoßen, sollten gerichtlich festgestellt, beim Namen genannt und gegebenenfalls nachrichtendienstlich beobachtet werden. Verfassungsschutzberichte sind viel effektiver und liberaler als Parteiverbotsanträge.
Nun sind die Repräsentanten der Partei wahrhaftig keine Unschuldslämmer. In mehreren Palastrevolten hat sich die Partei in den vergangenen Jahren in Wellen radikalisiert. Sie fördert Emotionalisierung wie Polarisierung durch Unterstellungen in einem beträchtlichen Maße und trägt so massiv zur Vergiftung des politischen Klimas bei. Es gibt Kräfte in der Partei, deren Positionen schwerlich mit demokratischen Positionen in Einklang zu bringen sind. Zugleich liefert die AfD auch genug Angriffsflächen in der Außen-, Innen-, Europa- und Wirtschaftspolitik.
Was bislang jedenfalls nicht funktioniert hat, ist die verbreitete Strategie der Dämonisierung und Entlarvung. Dafür wurden politische Streitfragen zu moralischen umgedeutet. Das begünstigt ein Freund-Feind-Denken. Es schwächt die offene Debattenkultur und gefährdet das Gebot der Liberalität. Die Polarisierung duldet in den Themen kein kühles Erwägen des besseren Arguments. Stattdessen wird stets versucht, eine Wortmeldung dem einen oder dem anderen Extrem zuzuschlagen.
Die Diskussion um ein AfD-Verbot ist ein Symptom für diese Illiberalität, in der sich die Rechtsradikalen so wohlfühlen. Die „Omas gegen rechts“, die Anfang August 2024 im thüringischen Landtag mit 300 Personen ihren ersten Bundeskongress abgehalten haben, fordern seit Jahren ein solches Verbot. Wäre es nicht überzeugender, für demokratische Positionen zu streiten und „rechts“ durch „extremistisch“ zu ersetzen? Dass selbst Linksliberale (nicht alle!) repressive Mechanismen befürworten, erhellt eine Verschiebung politischer Koordinaten und autoritäres Denken. Offenbar fühlen sie sich in der Defensive. Von den etablierten Parteien äußert die FDP die stärksten Vorbehalte gegen einen Verbotsantrag.
Keine Märtyrer schaffen
In der hitzigen Diskussion gerät ein zentraler Punkt oft in den Hintergrund: Ein Verbot der AfD ist weder möglich noch nötig. Es ist nicht möglich wegen der zu Recht hohen Hürden beim Bundesverfassungsgericht – und nicht nötig wegen der Unerlässlichkeit, die politische Auseinandersetzung argumentativ zu führen. Wird solchen substanzlosen Verbotsforderungen nicht Einhalt geboten, könnte es zu einem Verbotsantrag kommen, der dann scheitert! Es gäbe wohl kaum ein schöneres Geschenk für die AfD, als sie zur Märtyrerin zu machen. Die bundesdeutsche Demokratie ist im 75. Jahr ihrer Existenz stabiler, als viele derjenigen glauben, die ein AfD-Verbot befürworten.
Wenn Bürger der AfD ihre Stimme geben, zeigt das eine Repräsentationslücke. Besonders die irreguläre Immigration sorgt für Unmut und dafür, dass Wähler eine extremistische Partei bevorzugen, die diese als wichtig erachtete Thematik populistisch aufgreift. Insofern könnte die Existenz einer Partei wie der AfD eine Art Korrektiv sein, wenn eine inhaltliche Debatte mit deren Positionen auch in der politischen Mitte stattfindet. Etablierte Kräfte müssen Abhilfe schaffen, Probleme benennen und Lösungen entwickeln. Es gehört zur hiesigen politischen Kultur, politische Probleme rechtlich lösen zu wollen. Aber Wähler sollten über die Richtung der Politik entscheiden, nicht Sicherheitsbehörden oder Gerichte.
Mehr Vertrauen in unsere Demokratie
Die Bundesrepublik Deutschland ist längst keine Schönwetterdemokratie mehr. Wer daher die beiden einzigen Parteiverbote in den 1950er Jahren ebenso begrüßt wie das Scheitern der nachfolgenden Parteiverbotsanträge, argumentiert keineswegs widersprüchlich. In einem beträchtlichen Missverhältnis zum restriktiven Gebrauch vom Instrument des Parteiverbots steht die aufgeregte öffentliche Diskussion. Das ist schade, weil diese Entwicklung die Gefahr für die hiesige Demokratie überschätzt und die demokratischen Abwehrmechanismen unterhalb der Schwelle von Parteiverboten unterschätzt. Oft wird angemahnt, dass das Vertrauen in unser System gestärkt werden muss. Da wäre es ein guter Anfang, wenn man ihm mehr zutraut.
Der Populismus hat einen Hang zu einfachen Lösungen. Das wird zurecht kritisiert. Das Verbot jedoch ist die einfachste aller Lösungen. Eine Demokratie, die auf solche Maßnahmen zurückgreifen muss, ist in keinem guten Zustand. Ein Verbot ist besonders unnötig bei winzigen Parteien, wie das Bundesverfassungsgericht 2017 entschied. Bei größeren Parteien sieht das theoretisch anders aus. Allerdings sind die Folgen für den gesellschaftlichen Frieden schwer abzuschätzen. Für eine Demokratie ist es immer besser, politische Strömungen im Parlament abzubilden, als außerhalb.
Bei den ostdeutschen Landeswahlen im Herbst wird die AfD wohl so stark wie nie zuvor. Dreierlei verdient es, erwähnt zu werden: Erstens ist es immer noch eine Mehrheit, die anderen Parteien ihre Stimme gibt. Zweitens regt sich nun bei gesellschaftlichen Akteuren Widerstand. Ihre Sorge: Für ausfallende Schulstunden und vakante Arbeitsstellen die radikale Kraft keine Abhilfe schaffen. Schrittens tragen formelle und informelle Ausgrenzungsmechanismen weder zur Mäßigung noch zur Schwächung der AfD bei.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 148 – Thema: Netzwerke. Das Heft können Sie hier bestellen.